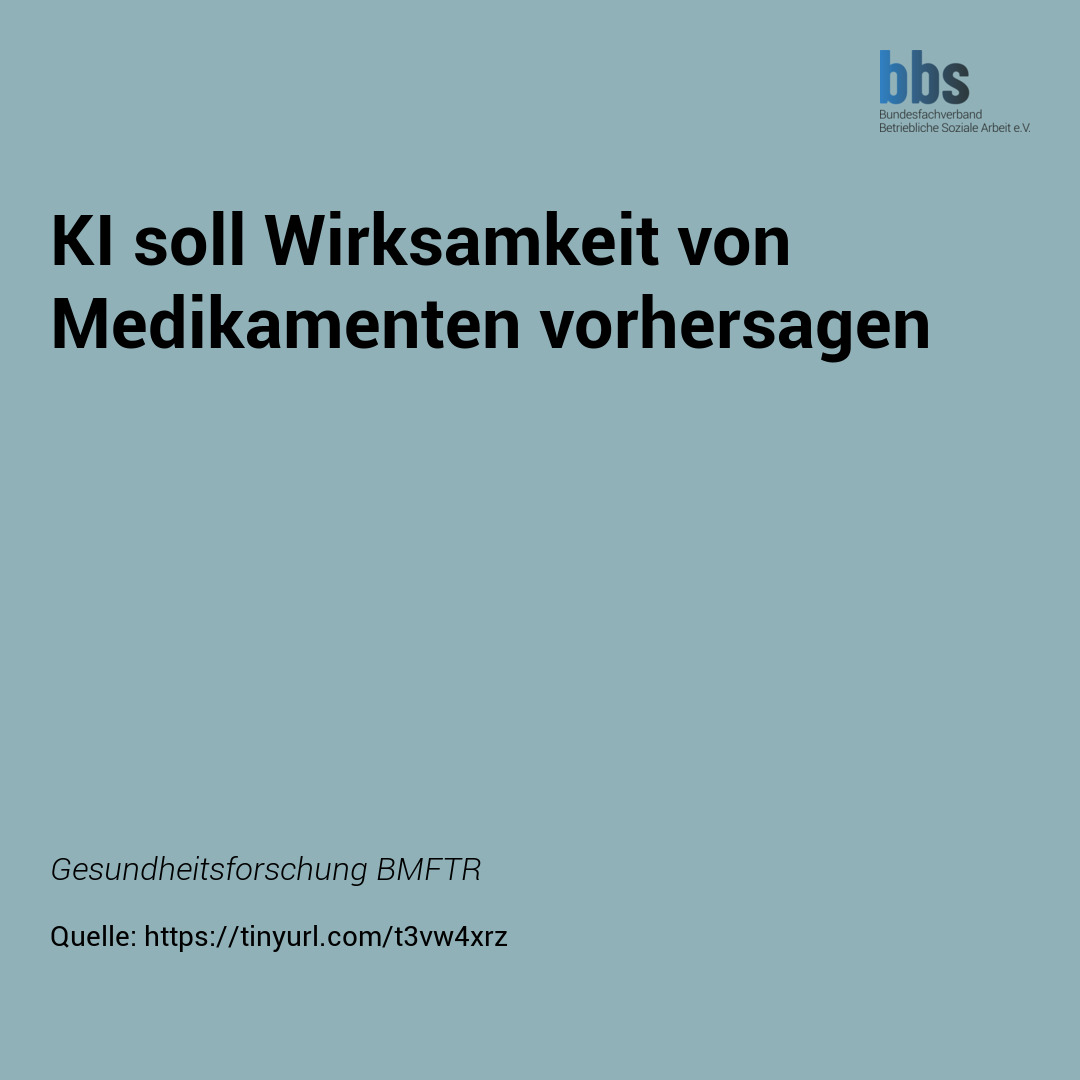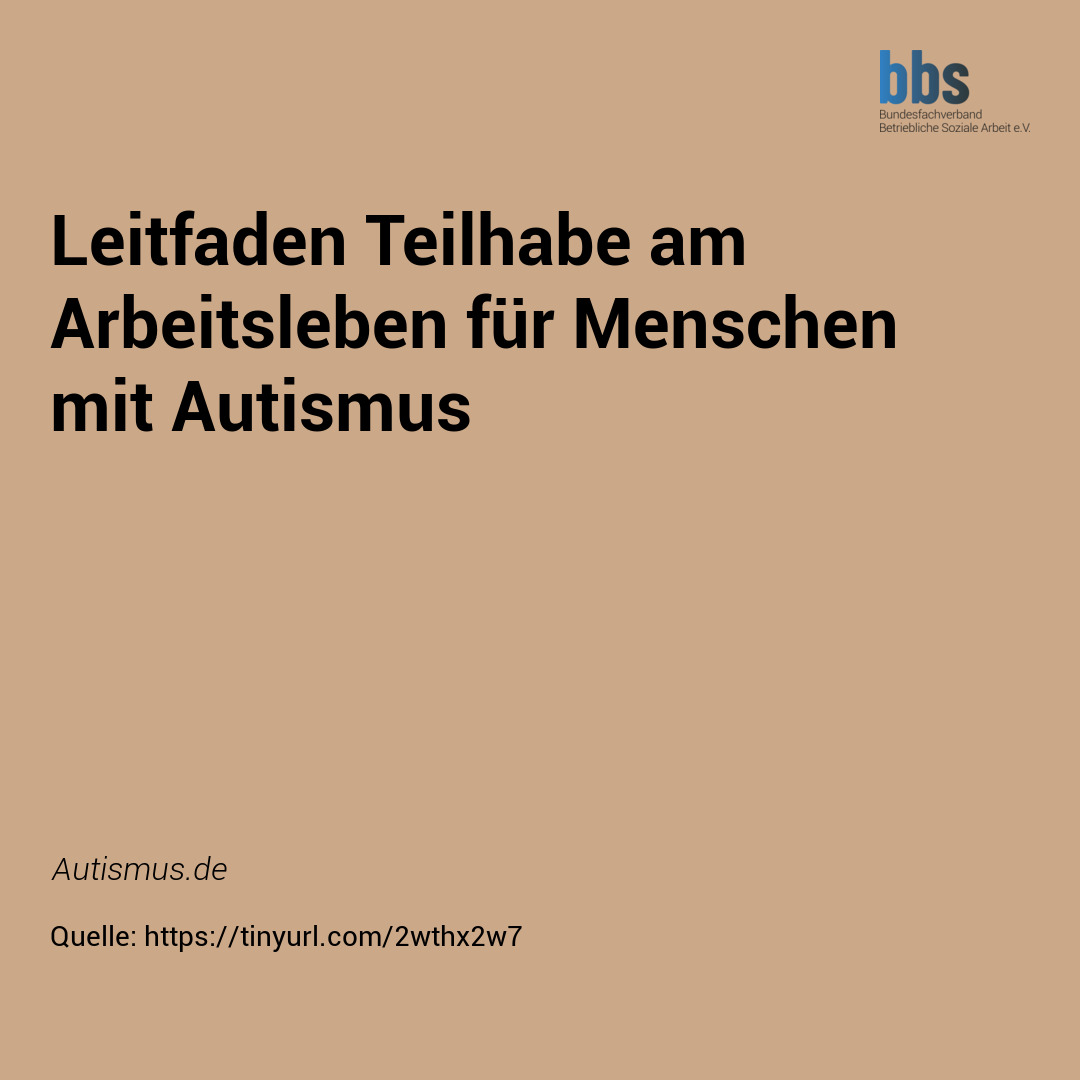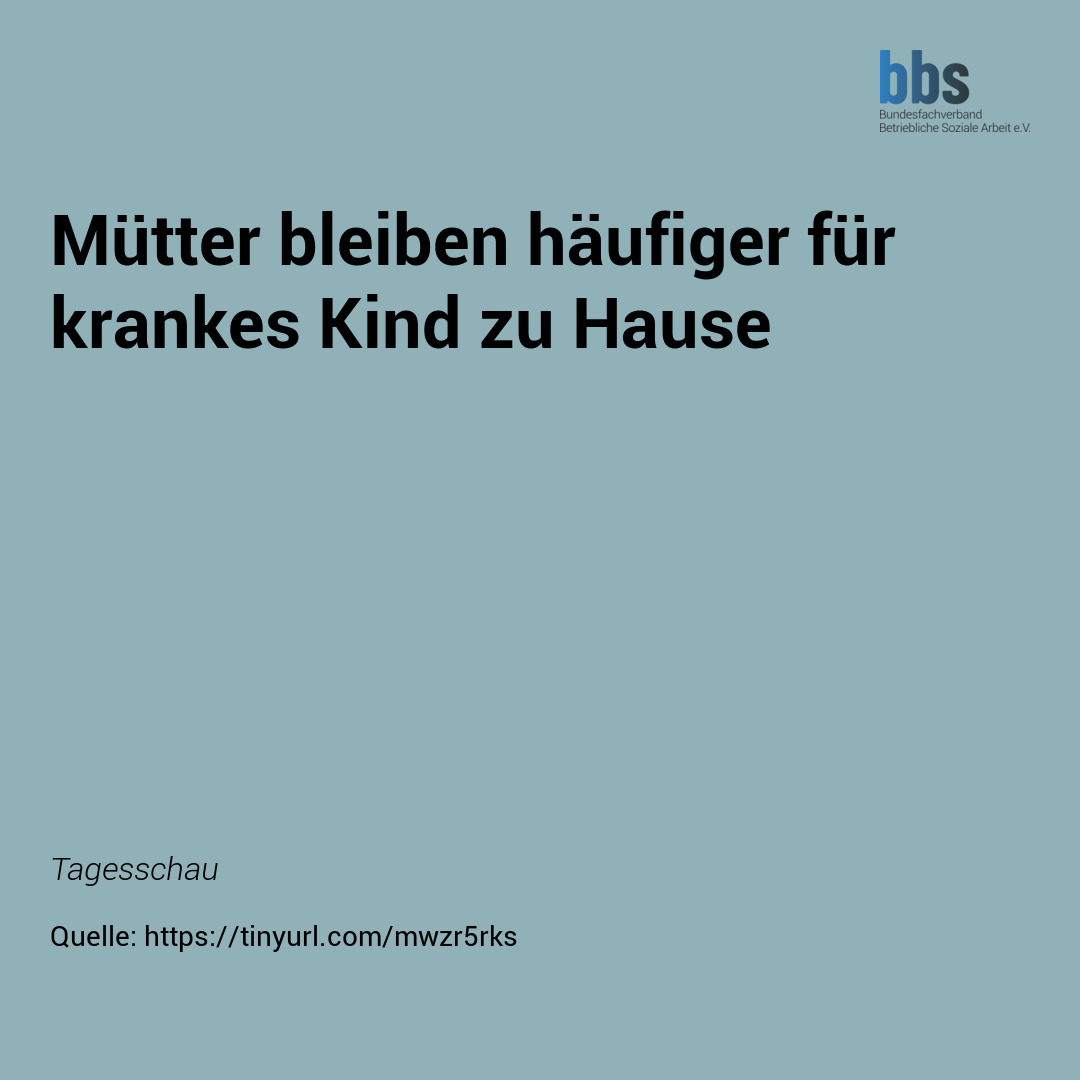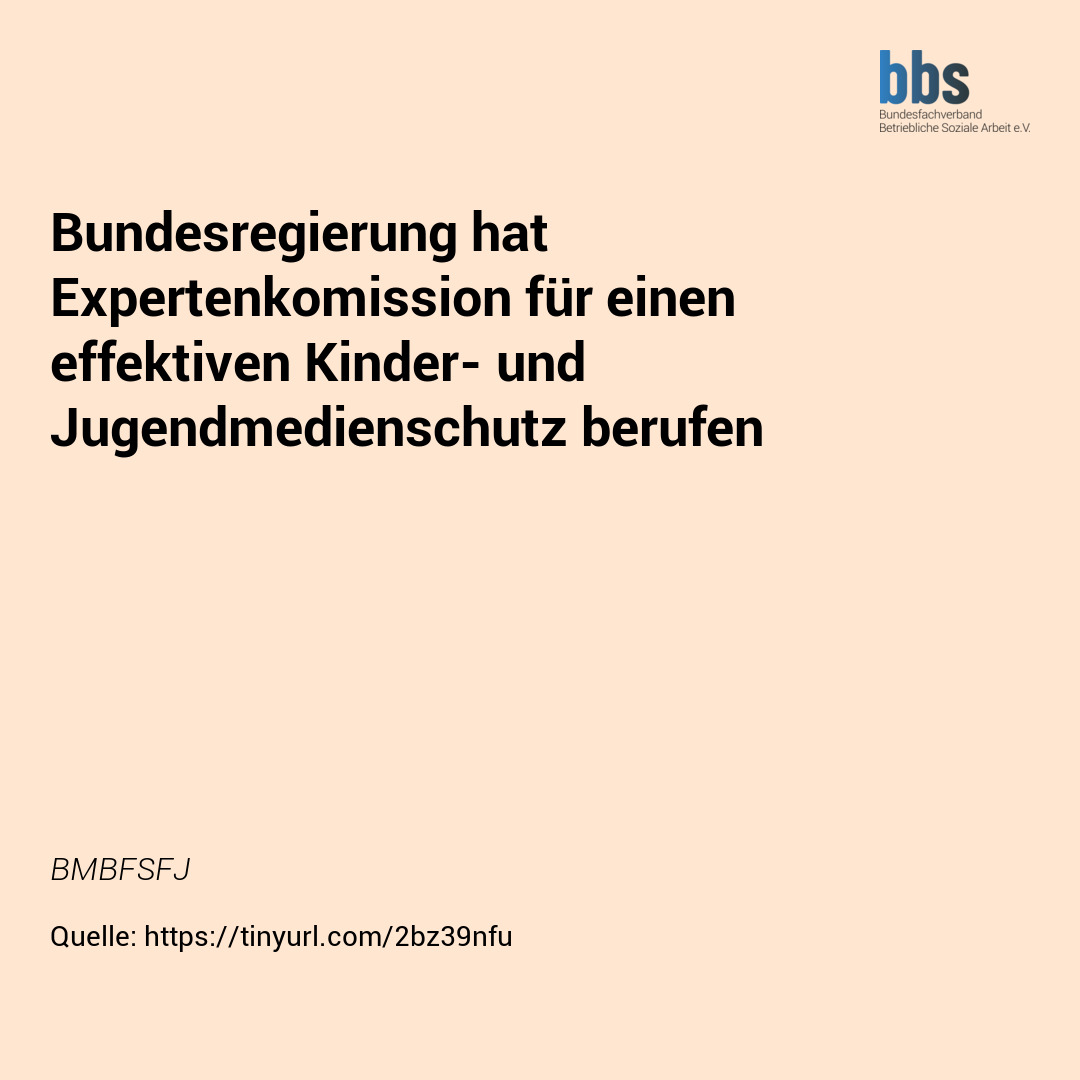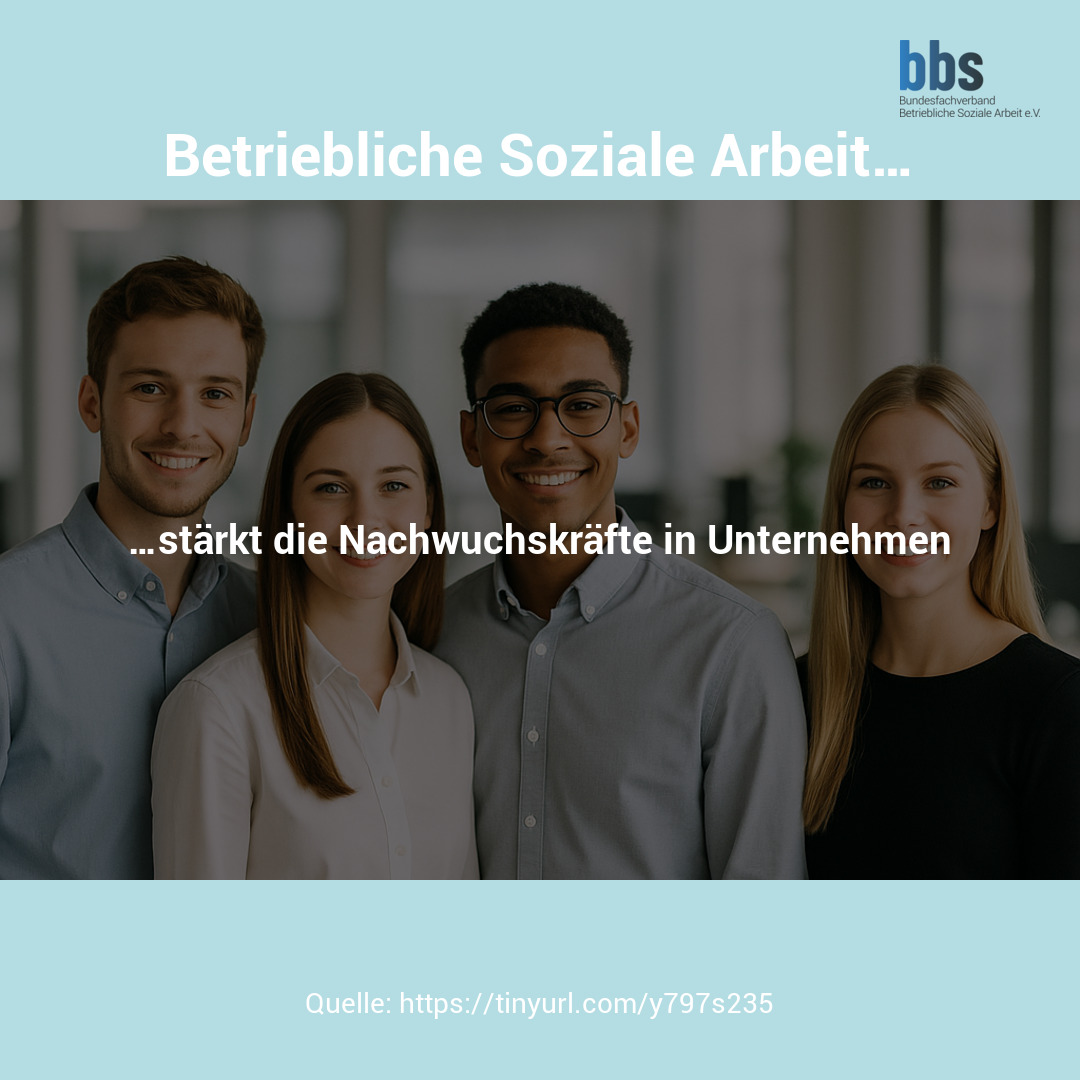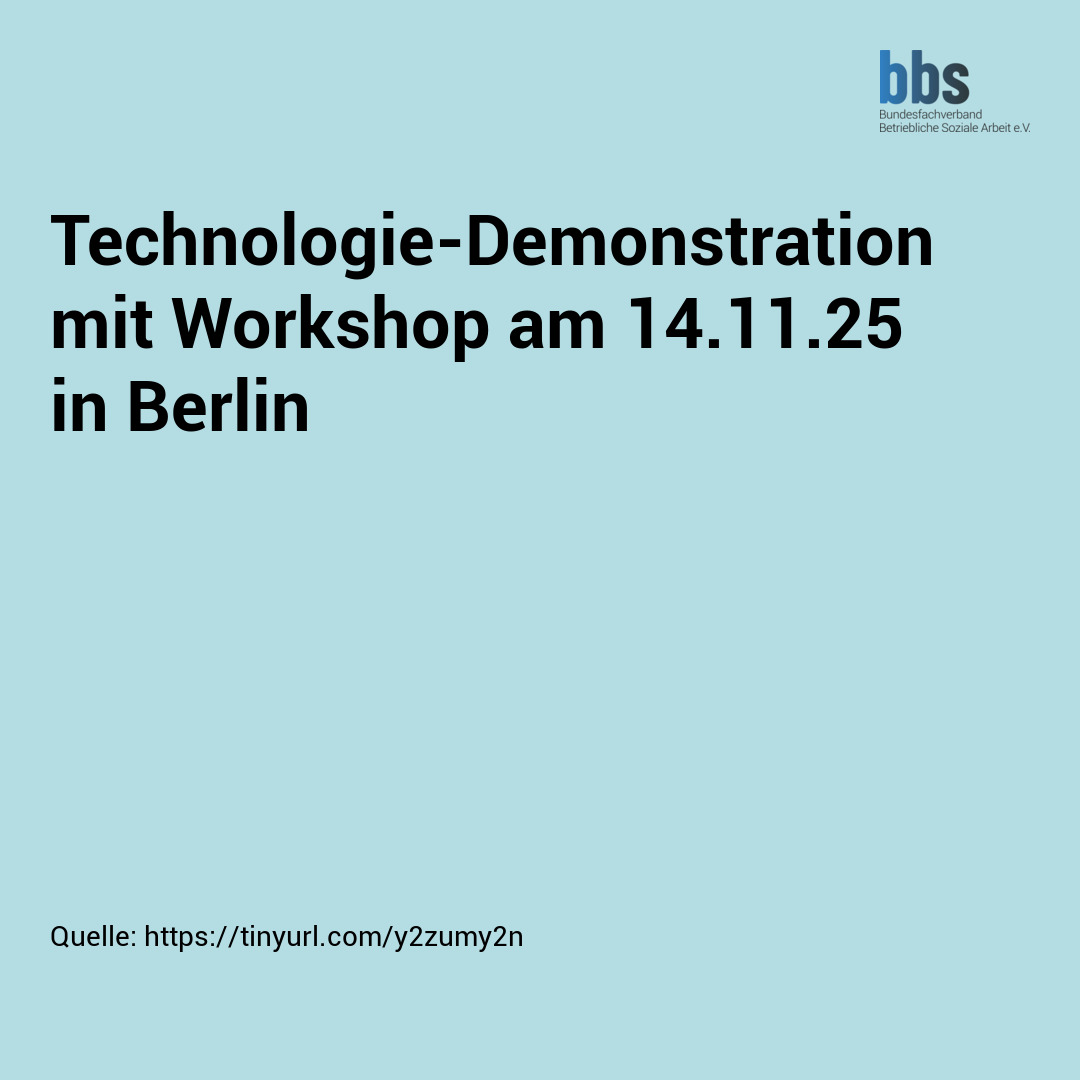Frische Meldungen
Social Media Feed
Das Unternehmen als sozialer Ort – langfristige Wirkungen der Pandemie und Schlussfolgerungen für die Gestaltung des New Normal
Das Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation zeichnet ein aktuelles Bild zu den Auswirkungen der großflächigen Veränderungen durch die Pandemie. Neben den beobachteten Effekten wird in der aktuellen Publikation (27.04.2022) herausgestellt, welche Strategien die Arbeitgeber zum Umgang mit der zukünftig hybriden Arbeitswelt entwickelt haben oder planen.
https://www.iao.fraunhofer.de/de/forschung/organisationsentwicklung-und-arbeitsgestaltung/befragungsreihe-arbeiten-im-new-normal.html
DAK-Gesundheit und Kommunikationsberatung MCC vergeben auch in diesem Jahr wieder den Förderpreis 2021 für Betriebliches Gesundheitsmanagement
Die DAK-Gesundheit und MCC schreiben den DEUTSCHEN BGM-FÖRDERPREIS 2022 bereits im siebten Mal aus. Der Preis würdigt Unternehmen, Organisationen und Einrichtungen, die sich kreativ und nachhaltig für das Betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM) einsetzen. Zudem unterstützt der Förderpreis die Gewinner dabei, ihre innovativen Ideen umzusetzen.
Der Wettbewerb ist mit insgesamt 60.000 Euro in Form von Sachleistungen dotiert. Einsendeschluss ist der 23. August 2022.
Dieses Jahr liegt der Fokus auf dem Thema „New Work & Führung“.
Technologische und gesellschaftliche Entwicklungen wie die Pandemie haben unsere Arbeitswelt verändert. Zahlreiche Unternehmen gestalten entsprechend ihre Arbeitsorganisationen um.
Das Arbeiten auf Distanz, virtuelle (Team)-Arbeit und Homeoffice haben während und aufgrund der Pandemie deutlich zugenommen. Flexibles und mobiles Arbeiten ist mittlerweile für viele Beschäftigte zur neuen Normalität geworden. Vieles deutet darauf hin, dass sich auch in Zukunft hybride Arbeitsmodelle, also eine Mischung zwischen mobiler und Präsenzarbeit, weiter durchsetzen werden.
Die neuen Arbeitsmodelle und flexiblere Arbeitsprozesse, bedingt durch die Marktanforderungen, stellen Arbeitsteams und speziell Führungskräfte vor besondere Herausforderungen.
Als neue Leitvorstellung gilt das agile Unternehmen, indem der Mensch im Vordergrund steht. Der Grad der Selbstorganisation in Arbeitsteams steigt und die Selbstverantwortung der Beschäftigten wird wichtiger.
Organisationskonzepte wie Arbeit 4.0, New Normal oder agiles Arbeiten haben Vor- und Nachteile und gehen mit unterschiedlichen Auswirkungen auf die gesundheitlichen Ressourcen und Belastungen der Beschäftigten einher. All diese Managementkonzepte setzen eine Vertrauenskultur voraus und müssen den Menschen psychische Sicherheit geben. Die Herausforderung für das jeweilige Unternehmen besteht darin, diese in ein dauerhaftes Gleichgewicht zu bringen. So ergeben sich vielfältige Möglichkeiten für eine gesundheitsfördernde und motivierende Ausgestaltung der Arbeitsbedingungen.
Gesucht werden die besten Ideen für die Thematik „New Work aktiv gestalten – Chancen für eine gesunde Führung nutzen“
Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf und bewerben Sie sich.
Ob Unternehmen, lokales Netzwerk im BGM oder Dienstleister mit konkretem Praxisvorhaben in einem Betrieb – jeder, der eine neue Idee im Gesundheitsmanagement entwickelt hat und umsetzen will, kann sich bewerben.
Eine hochkarätige Jury entscheidet über Gewinner!
Eine unabhängige Experten-Jury wird die Sieger ermitteln. Den Gewinnern winken Sachleistungen im Wert von 30.000 Euro (1. Platz), 20.000 Euro (2. Platz) und 10.000 Euro (3. Platz). Die Preisverleihung findet im Rahmen des Kongresses „Betriebliches GesundheitsManagement“ am 26. Oktober 2022 in Bonn statt.
Weitere Informationen, Teilnahmebedingungen und das Anmeldeformular zum Deutschen BGM-Förderpreis finden Bewerber unter: www.bgm-foerderpreis.de
Die DAK-Gesundheit ist mit 5,5 Millionen Versicherten eine der größten Krankenkassen in Deutschland. Bundesweit unterstützt sie Unternehmen dabei, sich vorausschauend für die Gesundheit ihrer Mitarbeiter zu engagieren. Dabei verfolgt sie einen ganzheitlichen und nachhaltigen BGM-Ansatz.
MCC steht seit 25 Jahren für professionelles Veranstaltungsmanagement. MCC konzipiert, organisiert und führt Veranstaltungen in unternehmerischer Eigenregie wie auch für andere Unternehmen durch.
Sollten Sie noch Fragen zur Bewerbung haben, wenden Sie sich einfach per E-Mail oder telefonisch an:
Philipp Kruse
E-Mail: info@bgm-foerderpreis.de
Tel.: 02421-12177-13
Patientenkongress Depression der Stiftung Deutsche-Depressionshilfe
Am 4. Juni 2022 fand der 6. Patientenkongress Depression in Frankfurt/Main statt. Für alle, die die Inhalte Revue passieren lassen wollen, gibt es einen Teil des Programms als Mitschnitte zum Nachverfolgen. Gefördert durch die Barmer können folgende Expertenvorträge als Videos bei YouTube angeschaut werden:
- Raus aus der Depression: Die Krankheit besser verstehen und behandeln, Prof. Dr. Ulrich Hegerl
- Medikamentöse Behandlung der Depression – aktueller Stand und neue Entwicklungen, Prof. Dr. Andreas Reif
- Neues aus der Forschung – Hirnstimulation bei Depression, Prof. Dr. Frank Padberg
- Psychotherapie bei Depression, Dr. Hanna Reich de Paredes
- Unterstützende Therapien bei Depression, PD Dr. Irina Falkenberg
- Depression in Kindheit und Jugend: Wie zeigt sie sich und wie kann man helfen?, Prof. Dr. Dr. Martin Holtmann
E-Learning zu Über- und Unterforderung am Arbeitsplatz
Um für das Thema Über- und Unterforderung am Arbeitsplatz zu sensibilisieren und darüber aufzuklären, hat das Institut für Arbeit und Gesundheit (IAG) der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung ein interaktives E-Learning entwickelt. Zum E-Learning des IAG
Merkmale einer positiven Fehlerkultur
Im Gegensatz zu einer Unternehmenskultur, die Fehler vermeidet oder gar vertuscht, möchte eine positive Fehlerkultur den Raum für Mitarbeitende öffnen, um sich zu entwickeln. Die Zeitschrift der Verwaltungs-Berufsgenossenschaft (VBG) „Certo“ stellt fünf Merkmale einer positiven Fehlerkultur vor. Zum Artikel der VBG
Kein Rückgang der gesamtwirtschaftlichen Arbeitsproduktivität durch Corona-Pandemie
Die gesamtwirtschaftliche Arbeitsproduktivität, gemessen als preisbereinigtes Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstätigenstunde, ist nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im 1. Quartal 2022 um 0,7 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum gestiegen.
Auch in den Jahren 2020 und 2021, die stark von den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie geprägt waren, lag die Arbeitsproduktivität je Stunde höher als im jeweiligen Vorjahr, mit Zuwächsen von +0,4 % (2020) und +1,1 % (2021).
Im Vergleich zum Vorkrisenjahr 2019 ergibt sich ein Anstieg um 1,5 %. Bei der Arbeitsproduktivität gab es jedoch große Unterschiede zwischen den einzelnen Wirtschaftsbereichen, da sich die zugrundeliegende preisbereinigte Bruttowertschöpfung (Output) und die geleisteten Arbeitsstunden der Erwerbstätigen (Input) in den Branchen unterschiedlich entwickelten.
Zwei Jahre Coronapandemie: Wie geht es Deutschlands Beschäftigten?
Der jährlich erscheinende Gesundheitsreport der Techniker Krankenkasse befasst sich in zwei Hauptabschnitten mit Arbeitsunfähigkeiten und mit Arzneimittelverordnungen. Neben den Routinedaten widmet sich der Report einem besonderen Schwerpunktthema.
Von den TK-versicherten Erwerbstätigen, die im Jahr 2020 eine COVID-19-Diagnose erhalten haben, war im Jahr 2021 knapp ein Prozent mit der Diagnose Long-COVID krankgeschrieben.
Bereits Long-COVID-Betroffene mit leichtem Verlauf einer Coronainfektion waren 2021 durchschnittlich 90 Tage krankgeschrieben. Long-COVID-Betroffene, die wegen ihrer Coronainfektion mehr als sieben Tage im Krankenhaus lagen, waren im darauffolgenden Jahr im Schnitt 168 Tage krankgeschrieben. Bei den Betroffenen, die im Krankenhaus beatmet werden mussten, waren es sogar durchschnittlich 190 Tage. Zum Vergleich: Im Schnitt war jede TK-versicherte Erwerbsperson im letzten Jahr 14,5 Tage arbeitsunfähig gemeldet.
Die Symptome von Long-COVID sind vielfältig und reichen von eingeschränkter Belastbarkeit und extremer Müdigkeit über Atemnot und Kopfschmerzen bis hin zu Muskel- und Gliederschmerzen. "Die Analyse zeigt: Wer von Long-COVID betroffen ist, hat lange mit dieser Krankheit - die uns ja noch so viele Rätsel aufgibt - zu tun", sagt Dr. Jens Baas, Vorstandsvorsitzender der TK."
Suchtmittelkonsum junger Menschen: Alkoholkonsum rückläufig, Raucherquote unverändert niedrig, Cannabiskonsum nimmt zu
Anlässlich des Weltdrogentags am 26. Juni legt die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) neue Ergebnisse der Studie „Der Substanzkonsum Jugendlicher und junger Erwachsener in Deutschland. Ergebnisse des Alkoholsurveys 2021 zu Alkohol, Rauchen, Cannabis und Trends.“ vor.
Prof. Dr. Martin Dietrich, Kommissarischer Direktor der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA): „Die neuen Daten zum Substanzkonsum junger Menschen zeigen insgesamt positive Entwicklungen. Immer mehr Jugendliche haben noch nie in ihrem Leben geraucht. Der Konsum von Alkohol bei Jugendlichen geht ebenfalls zurück. Doch sehen wir mit großer Sorge den Anstieg beim Cannabiskonsum junger Menschen. Die Hälfte der jungen Erwachsenen hat Erfahrung mit dem Konsum von Cannabis. Je früher Cannabis konsumiert wird, desto riskanter. Der Konsum von Cannabis kann die Entwicklung des Gehirns im Jugendalter beeinträchtigen. Diese gesundheitlichen Risiken dürfen nicht kleingeredet werden. Deshalb sind Präventionsangebote der BZgA speziell für junge Menschen wichtig, um sie frühzeitig über die Wirkweisen zu informieren und für die Risiken von Cannabis zu sensibilisieren.“
Alkoholkonsum
Die Studienergebnisse zeigen, dass aktuell 8,7 Prozent der 12- bis 17-jährigen Jugendlichen regelmäßig, also mindestens einmal wöchentlich, Alkohol trinken. Im Vergleich zu 21,2 Prozent im Jahr 2004 hat sich der Wert deutlich reduziert und erreicht den niedrigsten Stand seit Beginn der Beobachtung. Auch bei jungen Erwachsenen im Alter von 18 bis 25 Jahren ist der Anteil, der regelmäßig Alkohol trinkt, gesunken: Lag er im Jahr 2004 bei 43,6 Prozent, sind es aktuell 32,0 Prozent.
Rauchverhalten
Die Raucherquote liegt stabil auf historisch tiefem Stand: 6,1 Prozent der Jugendlichen und 29,8 Prozent der jungen Erwachsenen gaben im Jahr 2021 an, zu rauchen. Im Jahr 2001 waren es 27,5 Prozent der 12- bis 17-Jährigen und 44,5 Prozent der 18- bis 25-Jährigen.
Cannabiskonsum
Der Anteil der 18- bis 25-Jährigen, die schon einmal Cannabis konsumiert haben, ist von 34,8 Prozent im Jahr 2012 auf 50,8 Prozent im Jahr 2021 gestiegen.
Die BZgA informiert Jugendliche, Lehrkräfte und Eltern über die Risiken des Cannabiskonsums auf www.cannabispraevention.de. Das Internetportal www.drugcom.de bietet aktuelle und wissenschaftlich fundierte Informationen der Cannabisprävention für junge Menschen sowie für Fachkräfte und schon drogenaffine junge Menschen. Mit einem Online-Selbsttest „Cannabis-Check“ kann der eigene Umgang überprüft werden. Das Online-Verhaltensänderungsprogramm „Quit the shit“ unterstützt individuell und persönlich bei der Konsumreduzierung. Es kann kostenfrei und anonym genutzt werden und hat in verschiedenen Studien seine Wirksamkeit bestätigt.
Das Beratungstelefon der BZgA zur Suchtvorbeugung ist unter 0221 89 20 31 von Montag bis Donnerstag von 10 bis 22 Uhr und von Freitag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr erreichbar – zum Preis entsprechend der Preisliste des Telefonanbieters für Gespräche in das Kölner Ortsnetz. Es bietet die Möglichkeit zu einer persönlichen Beratung und informiert über Hilfs- und Beratungsangebote vor Ort.
Der Studienbericht zum Download: www.bzga.de/forschung/studien/abgeschlossene-studien/studien-ab-1997/suchtpraevention/
Ein Faktenblatt mit ausgewählten Ergebnissen des BZgA-Alkoholsurveys 2021 zum Download:
www.bzga.de/presse/daten-und-fakten/suchtpraevention
Gewalt gegen Beschäftigte des öffentlichen Dienstes
Das Deutsche Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung wurde vom Bundesministerium des Innern und für Heimat (BMI) beauftragt, das Ausmaß von Gewalt gegen Beschäftigte des öffentlichen Dienstes zu untersuchen. Ziel des Projektes ist es, eine Faktenbasis für die Entwicklung nachhaltiger und differenzierter Strategien zum Umgang mit Gewalt gegen Beschäftigte des öffentlichen Dienstes zu schaffen. Um ein möglichst umfassendes Bild zu erhalten, werden für die Untersuchung verschiedene Beschäftigungsbereiche (z. B. Ordnungsamt, Feuerwehr/Rettungskräfte, Sozial-/Arbeitsverwaltung) und Verwaltungsebenen (Bund, Länder, Kommunen) näher betrachtet.
Hier finden Sie eine Zusammenfassung der zentralen Ergebnisse des Forschungsprojekts.
Hier finden Sie einen Überblick über die Befragungsergebnisse zum Thema Gewaltprävention im öffentlichen Dienst.
Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ verzeichnet erneut Anstieg des Beratungsaufkommens
Auch im zweiten Jahr der Corona-Pandemie ist das Beratungsaufkommen beim Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ angestiegen. Im Jahr 2021 verzeichnete das Hilfetelefon mit mehr als 54.000 Beratungen ein Plus von fünf Prozent gegenüber dem Vorjahr. Bereits 2020 hatte es einen Anstieg um 15 Prozent gegeben. Die Mehrzahl der Beratungen (60 Prozent) betraf häusliche Gewalt.
Die Beraterinnen am Hilfetelefon führten im Jahr 2021 pro Woche mehr als 1.000 Beratungen durch.
Das bundesweite Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ richtet sich an gewaltbetroffene Frauen, an Menschen aus ihrem Umfeld sowie an Fachkräfte. Es berät kostenfrei, anonym und vertraulich zu allen Formen der Gewalt, darunter Partnerschaftsgewalt, Mobbing, Stalking, Zwangsverheiratung, Vergewaltigung und Menschenhandel. Mehr als 80 qualifizierte Beraterinnen sind unter der Telefonnummer 08000/116 016 sowie per E-Mail, Sofort- oder Terminchat auf www.hilfetelefon.de an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr erreichbar. Die Beratungen finden in 18 Fremdsprachen statt, darunter Englisch, Polnisch und Russisch. Seit Mai 2022 können Beratungen auch auf Ukrainisch angeboten werden.
Bielefelder Erklärung 2022 - "Soziale Arbeit und Macht"
Im Rahmen der 81. Jahrestagung der Gilde Soziale Arbeit haben die Mitwirkenden in Haus Bielefeld über "Soziale Arbeit und Macht" diskutiert. Vorläufiges Ergebnis dieser Beratungen ist die Bielefelder Erklärung „Soziale Arbeit fördert als praxisorientierte Profession und wissenschaftliche Disziplin gesellschaftliche Veränderungen, soziale Entwicklungen und den sozialen Zusammenhalt sowie die Stärkung der Autonomie und Selbstbestimmung von Menschen. Die Prinzipien sozialer Gerechtigkeit, die Menschenrechte, die gemeinsame Verantwortung und die Achtung der Vielfalt bilden die Grundlage der Sozialen Arbeit“, so die Funktionsbestimmung des IFSW (International Federation of Social Workers). Diese gewinnt gerade in Phasen gesellschaftlicher Krisen (Ökologie, Energie, Pandemie, Krieg) eine zusätzliche Bedeutung.
Seit der Gründung der Gilde Soziale Arbeit 1925 geht es darum, in „sozialbewegter Verbundenheit Antworten auf die drängenden Fragen der Zeit zu suchen und wohlfahrtsstaatliche Lösungen für die Not der Menschen anzubieten“.
11.667 Petitionen erreichten den Ausschuss im Jahr 2021
Im Jahr 2021 sind 11.667 Petitionen beim Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages eingereicht worden. Das geht aus dem Tätigkeitsbericht des Ausschusses für das Jahr 2021 (20/2200) hervor, den die Ausschussvorsitzende Martina Stamm-Fibich (SPD) Bundestagspräsidentin Bärbel Bas überreicht hat. Die Gesamtzahl der Petitionen ist damit im Vergleich zu 2020 gesunken (minus 2.647). Wie schon im Vorjahr bezogen sich die meisten der Eingaben - knapp ein Viertel - auf den Geschäftsbereich des Gesundheitsministeriums.
Schutz von Kindern vor sexualisierter Gewalt
Zusammen mit der Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs (UBSKM) startet das Familienministerium noch in diesem Jahr eine bundesweite Aufklärungs- und Sensibilisierungskampagne zum Schutz von Kindern vor sexualisierter Gewalt und Ausbeutung. Das kündigt die Bundesregierung in ihrer Antwort (20/2270) auf eine Kleine Anfrage (20/1618) der Fraktion Die Linke an. Ziel der Kampagne ist demnach die Sensibilisierung von Erwachsenen, die mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben. Sie sollen dazu aktiviert werden, sich mit dem Schutz von Kindern gegen sexualisierte Gewalt und mit Hilfeangeboten auseinanderzusetzen und bei Verdachtsfällen zu reagieren.
Rentenversicherung: Langfristszenarien und Reformoptionen
Die Deutsche Bundesbank hat einen interessanten Bericht (hier Auszug von 15 Seiten) zur Rentenversicherung veröffentlicht. Hier sind Langfristszenarien und Reformoptionen zu finden. Das passt ganz gut zu unserem Thema auf unserer diesjährigen Jahrestagung und dem Vortrag von Prof. Dr. Heribert Prantl und zu dem Buch "Lasst uns länger arbeiten" von Alexander Hagelüken, dass wir im ersten Quartal 2022 diskutiert haben.
Überschuldungsreport
In der Betrieblichen Sozialen Arbeit gehört das Thema Schulden zum Alltag. Wie sich die Pandemie auf das Thema Finanzen auswirkt und warum Alleinerziehende vermehrt von Überschuldung betroffen sind, sehen Sie hier.